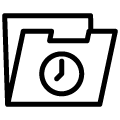Hygiene
Trinkwasser ist nicht zu 100 % frei von Mikroorganismen. Auch Krankheitserreger (Legionellen, Pseudomonaden, E. coli) können im Kaltwasser in geringen Konzentrationen enthalten sein. Das ist gesundheitlich so lange unbedenklich, bis sich diese Mikroorganismen über eine kritische Grenze hinaus vermehren.
Schon bevor die ersten Trinkwasserleitungen verlegt werden, kann man einiges für die Hygiene tun. Indem die Installation so ausgelegt wird, dass sie für Mikroorganismen weder Nahrung noch Lebensgrundlage bietet. Aber auch wenn eine Trinkwasserinstallation perfekt geplant und fachgerecht in Betrieb genommen wurde, besteht immer ein Risiko der Nachverkeimung. Hier kommen unsere Produkte ins Spiel.
Standdesinfektion
konzentriert gegen Keime
Auch wenn eine Trinkwasserinstallation perfekt geplant und fachgerecht in Betrieb genommen wurde – das Risiko der Nachverkeimung besteht immer. Insbesondere dann, wenn die Anlage nicht bestimmungsgemäß betrieben wird. In einem solchen Fall kann eine Standdesinfektion nötig werden. Das bedeutet: die diskontinuierliche Zugabe eines Desinfektionsmittels in hoher Konzentration. Am besten hat sich dafür Chlordioxid bewährt.

Trinkwasser-Desinfektion auf Nummer sicher
nach DVGW Arbeitsblatt W 557
Falls es zu einer Kontamination eines Trinkwassersystems mit Keimen kommt und weder betriebs- noch bautechnische Maßnahmen zur Beseitigung ihrer Ursache in Frage kommen, kann eine kontinuierliche Trinkwasserdesinfektion nach DVGW Arbeitsblatt W 557 hilfreich sein. Zu den zugelassenen Mitteln nach § 11 der Trinkwasserverordnung zählt ausdrücklich auch Chlordioxid.

UV-Entkeimung
Desinfiziert sicher. Ohne Chemikalien.
Die UV-Entkeimung gemäß DVGW Arbeitsblatt W 293 und W 294 desinfiziert sicher, ohne Zusatz von Chemikalien und ohne die Wasserinhaltsstoffe zu verändern. Voraussetzung für eine wirksame Behandlung ist klares Wasser mit geringer Absorption im relevanten UV-Bereich. Daher sind meist vorhergehende Aufbereitungsmaßnahmen nötig. Zur Herstellung von Trinkwasserqualität müssen DVGW- bzw. ÖNORM-geprüfte UV-Entkeimungsanlagen eingesetzt werden.

 © JUDO 2024 | Alle Rechte vorbehalten.
© JUDO 2024 | Alle Rechte vorbehalten.